Gastbeitrag | von Thomas Elbel
Warum die Copyright-Richtlinie keine Zensur einführt, die Meinungsfreiheit nicht zerstört und auch sonst mit dem Grundgesetz im Einklang ist.
Der Professor für Öffentliches Recht und Schriftsteller Thomas Elbel über die verfassungsrechtlichen Implikationen des heiß umkämpften Artikels 13 im Gesamtkontext der EU-Urheberrechtsrichtlinie.

Der Vorwurf der ZENSUR
Überall heißt es, die Copyright-Richtlinie führe zu Zensurmaschinen. Jetzt steht natürlich jedem sein eigener Zensurbegriff frei, aber die Bezeichnung macht nach meinem Verständnis nur dann Sinn, wenn sie zu Recht auf den verfassungsrechtlichen Zensurbegriff des Art. 5 Abs. 1 S. 3 des Grundgesetzes gründet. Schon Internet-Doyen Sascha Lobo hat in einer Kolumne auf SPON vom 2.1.19 („Blocken in sozialen Medien ist Freiheit, keine Zensur“) darauf hingewiesen, dass eine Überdehnung des Zensurbegriffes unsinnig ist. Er wird dadurch am Ende zu einer sinnfreien Leerformel, der keine Bezeichnungsmacht mehr zukommt. Die Uploadfilter, von denen in der Debatte um die Copyright-Richtlinie die Rede ist, sind aber aus zwei Gründen niemals Zensur.
Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, dass der umstrittene Art. 13 der Copyright-Richtlinie Filter gar nicht zwingend vorschreibt. Der Hase liegt nämlich woanders im Pfeffer. Das vergleichsweise schwächere Argument wäre zunächst einmal, dass wenn ein solcher Filter z.B. von YouTube (soll jetzt mal stellvertretend für die betroffenen Plattformen stehen) eingerichtet würde, dieser ja ein privates Instrument wäre.
Der verfassungsrechtliche Zensurbegriff erfasst aber nur staatliche Eingriffe in den Meinungsmarkt.
Wäre auch ein privater Eingriff Zensur, wäre ja jede Ausübung der Richtlinienkompetenz eines Zeitungsverlegers ein Fall von Zensur.
Man könnte natürlich insoweit gegenargumentieren, dass die Filter hier indirekt vom Staat vorgegeben wären, jedenfalls wenn man in der Richtlinie eine entsprechende Verpflichtung mittelbar erkennen will, aber selbst dann fehlt für Zensur noch ein weiterer wichtiger Aspekt, nämlich die Gezieltheit des Eingriffs. Zensur im Sinne des Grundgesetzes ist nämlich nicht jeder beliebige staatliche Eingriff in den Meinungsaustausch, sondern nur ein solcher, der gezielt in einen bestimmten Teil des Meinungsspektrums eingreift, z.B. ein Verbot aller Gegenäußerungen zur Copyright-Richtlinie. Ein unterschiedsloser Eingriff in alle Meinungen aber, egal ob nun links, rechts, liberal oder was auch immer, ist keine Zensur. Diese Interpretation des Zensurbegriffes ergibt sich aus der Zusammenschau des Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG mit Abs. 2 derselben Vorschrift, wo es heißt, dass die Rechte aus Abs. 1 unter der Schranke der „allgemeinen Gesetze“ stehen. Der Staat darf also durchaus in die Meinungsfreiheit eingreifen, so lange der Eingriff lediglich „allgemein“ oder im Sinne meiner vorangegangenen Begriffsbildung „ungezielt“ ist.
Diese Auslegung des Zensurbegriffs ergibt sich z.B. aus folgendem Zitat aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts:
„Unzutreffend ist die Annahme des Beschwerdeführers, das Verbot der Verbreitung komme einer Vorzensur gleich. Art. 5 GG, der das Zensurverbot aus Absatz 1 Satz 3 neben die Schrankenbestimmung des Absatzes 2 stellt, verdeutlicht schon durch dieses Nebeneinander, dass das Zensurverbot nicht betroffen ist, wenn zur Durchsetzung eines in einem allgemeinen Gesetz geschützten Rechtsguts die dort vorgesehenen Rechtsschutzmöglichkeiten genutzt werden. Eine auf die Unterlassung einer konkreten Persönlichkeitsverletzung zielende gerichtliche Entscheidung steht der behördlichen Vorprüfung oder Genehmigung des Inhalts einer Veröffentlichung nicht gleich (zum Zensurverbot vgl. BVerfGE 33, 52 <71 ff.>).“; aus: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2006/05/rk20060502_1bvr050701.html
Uploadfilter können also in diesem Sinne auch deswegen keine Zensur sein, da sie unterschiedslos das gesamte Meinungsspektrum betreffen.
Trotzdem findet sich das besagte Mem von den Uploadfiltern als Zensurmaschinen in gefühlt jedem zweiten kritischen Beitrag zur Copyright-Richtlinie, so z.B. auch in einem Beitrag vom 28.2.19 auf dem Blog des von urheberrechtskritischen Stimmen seit Jahren immer wieder gern zitierten Münchner Anwalts Thomas Stadler. Der sehr stimmgewaltige Herr Stadler wird einem ob seiner vielfachen Äußerungen zu allen möglichen Themen des Medienrechts darum auch immer wieder gerne als Experte präsentiert. Leider scheint der Gedanke weniger populär, dass derartige Anwaltsblogs ja in erster Linie auch Werbeplattformen sind, die sich inhaltlich primär an die jeweilige Mandantschaft richten. Schaut man sich die Tätigkeitsschwerpunkte von Herrn Stadler auf dessen Anwaltswebsite an, so fällt auf, dass er vornehmlich um Mandantschaft wirbt, die aus medienrechtlichen Vorschriften in Haftung genommen wird. Es ist nicht weiter verwunderlich, wenn er in seinen öffentlichen Äußerungen diesem Klientel sympathische Positionen einnimmt. Da müsste man doch derartige Äußerungen eigentlich mit einem Körnchen Salz nehmen. Aber in der öffentlichen Debatte wirkt es mitunter, als ob Herr Stadler, oder sein auch sehr gern zitierter Kollege Solmecke in ihren Blogs quasi neutrale und wissenschaftlich fundierte Fachartikel zum Besten geben.
Der Vorwurf der EINSCHRÄNKUNG DER MEINUNGSFREIHEIT
Aber das ist nicht der einzige Behauptungsfehler der Richtliniengegner. Ein weiteres Beispiel: Eine der Kernaussagen der Gegnerschaft von Art. 13 ist ja sinngemäß: Uploadfilter führen zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil sie eine immense Anzahl so genannter „False Positives“ produzieren werden. Denn eine KI kann z.B. nicht erkennen, dass statt einer Urheberrechtsverletzung nur eine gesetzlich erlaubte Parodie oder ein Zitat vorliegt (letzteres hat mich übrigens nie überzeugt; warum sollte eine KI nicht den Unterschied zwischen Original und Teilmenge des Originals erkennen, aber wie auch immer).
Was mich an dieser Behauptung stört ist, dass sie aus einer Kette von Axiomen, also beleglosen Tatsachenbehauptungen („KI kann nicht erkennen, dass …“) und ebenso beleglosen oder letztlich sinnfreien, weil referenzlosen Bewertungen („immense Anzahl von False Positives“) zusammengesetzt ist.
Ich möchte etwas näher ausführen, wie ich das meine. Dazu möchte ich so tun, als sei Art. 13 bereits erlassen und findige Gegner versuchten nun, der Vorschrift auf dem Rechtsweg den Garaus zu machen, denn das ist ja auch kein völlig unrealistisches Szenario. Ich hoffe, die geneigten Leserinnen und Leser interpretieren es nicht allzu sehr als berufliche Eitelkeit, wenn ich behaupte, dass eine derartige juristische Betrachtungsweise hilft, der obigen Behauptung den Nebel auszutreiben. Dazu beginne ich mit einem Beispielssachverhalt:
Der deutsche Staatsbürger Ulrich Uploader (U) lädt die berühmte Würgeszene mit Darth Vader und Moff Tarkin aus Star Wars IV auf YouTube hoch. Der Szene ist eine für eine halbe Sekunde sichtbare Tafel mit dem Text „Groko-Kabinett-Besprechung“ vorgeschaltet. U will das als Kritik an der momentanen Regierung und ihrer Liebe zu „imperialer Politik“ verstanden wissen.
Unterstellen wir für Zwecke des Falles mal, dass der Filmrechteinhaber der betreffenden Szene ein europäisches Unternehmen wäre. Dieses Unternehmen hat YouTube keine Lizenz zum Zeigen des Films oder von Ausschnitten davon gegeben. Selbstverständlich sind alle bekannten Schranken des deutschen Urheberrechts (Zitat, Parodie etc.) anwendbar. YouTube hat sich entschieden, das Problem des Hochladens nichtlizenzierter Filme – wie jeher – durch sein Filtersystem ContentID zu lösen, das seit Einführung des Art. 13 flächendeckend eingesetzt wird.
ContentID identifiziert das von U hochgeladene Video trotz der vorgeschalteten Texttafel als schlichten Filmausschnitt und löscht ihn daher noch vor Abschluss des Hochladevorgangs.
U beschwert sich bei YouTube über das von der Richtlinie vorgesehene Beschwerdeverfahren (Art. 13 Abs. 8 des aktuellen Entwurfes). Würde YouTube dem nun stattgeben und den Content hochladen, wäre der Fall hier bereits zu Ende, da U ja bekommen hätte, was er will. Gehen wir also davon aus, dass YouTube – im Rahmen der Nachkontrolle, die nunmehr logischerweise von einem echten Menschen durchgeführt wird – nicht abhilft, weil man dort der Meinung ist, die Szene stelle allein aufgrund der vorgeschalteten Tafel keine Parodie im Sinne der auf U anwendbaren deutschen Schrankenbestimmungen und ihrer europäischen Ausgangsnormen dar.
Was kann U jetzt noch machen?
Richtig. Klagen
Erster Teil: Rechtsstreit U vs. YouTube – 1. Instanz
Es stellt sich die Frage: Wo würde U eigentlich klagen? Da es sich hier im Kern um einen Rechtsstreit über die Reichweite einer deutschen Urheberrechtsschrankenbestimmung – also Zivilrecht – handelt, und beide Parteien, YouTube und U sich auf Augenhöhe begegnen, mithin der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet ist, geht der Rechtsstreit zur ordentlichen Gerichtsbarkeit. Meinen eigenen Recherchen zufolge ist in so einem Fall eine Überschreitung der Streitwertgrenzen für einen Rechtsstreit beim Landgericht durchaus denkbar. Gehen wir also mal davon aus, die 1. Instanz findet vor der Zivilkammer eines deutschen Landgerichts statt. Gewinnt U, ist der Rechtsstreit wiederum zu Ende, da er bekommen hat, was er will. YouTube müsste den Clip dann hochladen. Also gehen wir davon aus, dass das Landgericht YouTubes Argumentation aus dem Beschwerdeverfahren folgt und den Clip als von den deutschen Schrankenbestimmung nicht erfasst ansieht.
Zweiter Teil: Berufung
Genauso geht es dann vor dem Oberlandesgericht weiter.
Dritter Teil: Revision
Und schließlich – wenn die Revision zugelassen wird (was ich angesichts der Tatsache, dass Streits um die Reichweite urheberrechtlicher Schrankenbestimmungen heutzutage wohl kaum grundsätzliche Bedeutung haben dürften, allerdings für eher unwahrscheinlich halte) – auch vor dem BGH, der sich dann, damit es mit unserer Betrachtung weitergehen kann, ebenfalls YouTubes Sicht anschließt, es handele sich nicht um eine Parodie.
Sodele.
Und jetzt käme (jedenfalls in Abwesenheit einer auch von den Untergerichten initiierbaren so genannten konkreten Normenkontrolle i.S.v. Art. 100 GG) überhaupt erst und auch nur eventuell das BVerfG ins Spiel. Nämlich dann, wenn der U – seinen Misserfolg bis hierhin unterstellt – Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BGH erhebt.
Nun muss man allerdings wissen, dass das BVerfG – anders als z.B. der US Supreme Court – keine „Superrevisionsinstanz“ ist. D.h. es würde sicher nicht nur deshalb tätig, weil z.B. der BGH bei der Auslegung der urheberrechtlichen Schrankenbestimmung etwas zu engstirnig war.
Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass das BVerfG eine derartige Beschwerde gar nicht erst zur Entscheidung annehmen würde.
Aber unterstellen wir aber mal „for the sake of the argument“, das BVerfG würde den Rechtsstreit zur Überprüfung annehmen. Dann wäre Prozessstoff aber wiederum nur die Frage der Weite der urheberrechtlichen Schrankenbestimmung zur Parodie und ob YouTube in diesem Sinne zur Löschung berechtigt war oder nicht.
Die Richtlinie würde in diesem Rechtsstreit also gar keine direkte Rolle spielen. Sie könnte daher m.E. auch nicht Gegenstand der verfassungsgerichtlichen Überprüfung sein.
Und selbst wenn sie das wäre und U sich irgendwie – ich weiß nicht wie, aber unterstellen wir einfach, es ginge – darauf beriefe, dass der Einsatz der Filter durch YouTube in seinem Fall sein Grundrecht auf Meinungsfreiheit verletzt. Was wäre denn dann?
Nun dann würde zuerst mal die Frage im Raum stehen, ob die Meinungsfreiheit im Verhältnis zwischen U und YouTube überhaupt Anwendung findet, denn die Grundrechte unserer Verfassung binden laut Art. 1 Abs. 3 Grundgesetz primär nur den deutschen Staat und nicht irgendwelche amerikanischen Unternehmen.
Etwas anderes könnte höchstens gelten, wenn wir der Lehre des BVerfG von der Einstrahlungswirkung der Grundrechte in privatrechtliche Rechtsverhältnisse folgen und die Frage stellen, welche Auswirkung die Meinungsfreiheit auf die Entscheidung YouTubes hätte, Uploadfilter zum Einsatz zu bringen. Und damit wir jetzt irgendwie – ich weiß nicht genau wie – zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der Richtlinie kommen, um die es den Art.-13-Gegnern ja eigentlich geht, nehme ich an, müsste YouTube nun die recht gewagte Argumentation aufmachen, dass die Richtlinie YouTube zur Anwendung von Uploadfiltern quasi zwingt.
Darauf würde ich als Verfassungsrichter fragen, wo denn in der besagten Richtlinie irgendetwas von Uploadfiltern steht. YouTube würde kurz rot anlaufen und dann irgendetwas von ökonomisch einzig handhabbarer Lösung faseln. Der Verfassungsrichter würde dem dann aber möglicherweise entgegenhalten, dass ein Unternehmen mit geschätzten 8 Milliarden Werbeeinnahmen im Jahre 2019 das Problem der Filterung doch eventuell auch mit einer Kombination aus künstlicher UND humanoider Intelligenz lösen könne. Der YouTube-Anwalt würde sich nun mächtig aufplustern und geltend machen, dass man da ja angesichts von 400h Uploads pro Minute ganze Armeen von Personal anstellen müsste. Die Richter würden wiederum einwenden, die Tatsache, dass stattdessen eine rein automatisierte Filterung angewandt werden solle, sei ökonomisch sicherlich nachvollziehbar, aber letztendlich eben doch eine autonome Entscheidung des Konzerns und könne nicht dem Gesetzgeber angelastet werden, was man ja auch daran sehe, dass ContentID auch schon vor Erlass der Richtlinie angewandt wurde. Gewinnschmälerungen, die wiederum durch eine grundrechtsfreundlichere Variante verursacht würden, müssten vom Konzern dann eben hingenommen werden. Außerdem, so würde ein besonders findiger Verfassungsrichter einwenden, sei es ja kein Naturgesetz, dass Youtube-Postings immer schon wenige Augenblicke nach dem Upload veröffentlicht sein müssten. Eine gewisse Wartezeit sei aus Sicht der User sicherlich auch vor dem Hintergrund der Meinungsfreiheit hinnehmbar. Wer einen papiernen Leserbrief an die Zeitung schreibe, müsse ja auch damit rechnen, dass dieser erst ein paar Tage später veröffentlicht werde. Manchmal sei eine gewisse Entschleunigung in einer Debatte ja vielleicht sogar qualitätsfördernd, würde der Richter mit süffisantem Lächeln hinzufügen.
Was es abzuwägen gilt
Warum dieser detaillierte Ausblick des Verlaufs der Klage eines Bürgers gegen eine von ihm behauptete False-Positive-Löschung? Um zu demonstrieren, dass der Streitstoff hier nicht die platte Frage „Uploadfilter, ja oder nein“ sein wird, sondern eher die Frage, ob YouTube den beiden Vorgaben der Richtlinie „best efforts“ gegenüber den Rechteinhabern und „Verhältnismäßigkeit“ gegenüber den Nutzern gerecht geworden ist. Dabei spielen YouTubes ökonomische Erwägungen m.E. nur eine untergeordnete Rolle, denn es kann von einem Unternehmen erwartet werden, dass es jeden erdenklichen Aufwand auf sich nimmt, wenn es darum geht zu gewährleisten, dass sein Geschäftsmodell die Rechte Dritter nicht verletzt.
Alte Bekannte: Von Störern und Tätern
An dieser Stelle ist vielleicht ein kleiner Exkurs ganz passend: Haben Sie, liebe Leser, im Zusammenhang mit der Urheberrechtsdebatte auch schon den Begriff der Störerhaftung gehört und sich gefragt, was damit gemeint ist? Vor zwei bis drei Jahren war damit im Zusammenhang mit der Haftung von privaten Betreibern offener W-LANs viel die Rede. Damals hieß es oft, den armen W-LAN-Betreibern solle etwas völlig Exotisches übergeholfen werden. Ich als Jurist habe mir da nur die Augen gerieben, denn die Störerhaftung ist im deutschen Zivilrecht eigentlich der Default. Auf ihren abstrakten Kern zurückgeführt, bedeutet Störerhaftung, dass ich Ihnen dafür hafte, wenn mein Eigentum schädlich auf Ihr Eigentum einwirkt. Wenn also meine Brieftaubenzucht dazu führt, dass ihre Hauszufahrt immer voller Taubenkot ist, hafte ich ihnen auf Entfernung.
Störerhaftung
erfasst darüber hinaus aber auch noch den Fall, dass mein Eigentum
so konfiguriert ist, dass es Dritten die Möglichkeit gibt, schädlich
auf Ihr Eigentum einzuwirken. In diesem Fall hafte ich – etwas
vergröbert ausgedrückt – dann, wenn ich (a) davon weiß, (b) nicht
gegen die Dritten einschreite und wenn (c) eine direkte
Inanspruchnahme der Dritten durch Sie nicht erfolgversprechend ist.
Beispiel: Ich veranstalte in meiner Schreberlaube regelmäßig
Partys, bei denen meine Gäste den Müll auch in ihren angrenzenden
Garten entsorgen. Ihre Tulpenzucht leidet massiv. Auf entsprechenden
Hinweis von Ihnen gebe ich zu Protokoll, dass Partys nun mal zum
Leben dazu gehören. Außerdem bin ich aus Datenschutzgründen nicht
bereit, Ihnen die Namen meiner Gäste zu verraten. In solch einem
Fall hätten Sie gute Chancen, sich die Instandsetzungskosten bei mir
gerichtlich zu erklagen.
Zurück zu YouTube und den anderen
UGC-Plattformen: Im Sinne des Konstrukts der Störerhaftung müsste
YouTube eigentlich sowieso für die Rechtsverletzungen haften, die
die Nutzer vermittelst der Plattform an den Urheberrechten Dritter
verursachen. Dass dem heute nicht so ist, liegt daran, dass YouTube
durch das so genannte Providerprivileg des § 10 TMG von der
Störerhaftung ausgenommen ist. Das muss man sich für die Zwecke der
aktuellen Debatte mal deutlich vor Augen führen: Die Störerhaftung
ist der Default, das Providerprivileg die Ausnahme.
Wie kam es eigentlich dazu? Weil in den 90er-Jahren eine gewisse gelb-blaue Partei der ultimativen Freiheit mit an der Regierung war. Diese hat damals das Argument geäußert, dass sich, wenn für die Netzwirtschaft dasselbe Haftungsregime gälte wie für Otto Normalverbraucher, das noch junge Internet nie mit Angeboten bevölkern würde. Heute wissen wir, dass das Internet bis an die Halskrause „bevölkert“ ist, aber Bitkom, Eco und wie sie alle heißen, krallen sich – aus ökonomischer Perspektive völlig verständlich – an ihrem Privileg fest. Die Copyright-Richtlinie ist insoweit auch ein Versuch, den Normalzustand der Haftung wieder herzustellen. Man könnte polemisch ausgedrückt konstatieren, dass die Urheber auf Grundlage der derzeit noch geltende Privilegierung die offensichtlich in eternam perpetuierte Startup-Phase der großen Internetplattformen mitfinanzieren.
Aber zurück zu den prozessualen Möglichkeiten, die Copyright-Richtlinie überprüfen zu lassen:
Nun kann man sich fragen, wie man denn dann zu einer Direktüberprüfung der (in der Richtlinie eigentlich gar nicht statuierten) Uploadfilter-„Pflicht“ durch die Verfassungsbeschwerde eines Einzelnen kommen würde, wenn es auf dem bereits beschriebenen Weg nicht so richtig klappt?
Die Antwort wäre: indem der WIRKLICHE Direktbetroffene gegen die Richtlinie klagt und das wäre im Ausgangsfall eben nicht U, sondern YouTube (oder eine andere betroffene Plattform).
Überprüfung der RL, Option a: Klage der Plattform
Jetzt könnte man
gleich die Frage stellen, wogegen YouTube denn klagen würde, weil es
in dem Ausgangsfall selbst ja gar nicht beschwert wäre und das
deutsche Recht kennt keine Popularklage, wo man quasi gegen anderer
Leute Elend zu Felde zieht. Eine Klage YouTube vs.
Copyright-Richtlinie wäre daher nur dann denkbar, wenn YouTube z.B.
gegen eine sanktionsbewehrte Pflichtnorm aus dem deutschen
Umsetzungsgesetz verstoßen würde.
Beispiel: YouTube
verweigert sich sowohl der Lizenzierung als auch irgendwelcher Form
der vorauseilenden oder nachträglichen Löschung nichtlizenzierter
Inhalte und wird daher mit einer Ordnungswidrigkeitenstrafe belegt.
Dann könnte YouTube gegen den betreffenden Verwaltungsakt erst mal Beschwerde vor den ordentlichen Gerichten (in diesem Fall Strafgerichtsbarkeit) erheben und bei Nichterfolg dann damit vor das Verfassungsgericht ziehen.
In diesem Fall wäre es in der Tat denkbar, dass das Verfassungsgericht die Pflichten von YouTube unter dem deutschen Umsetzungsgesetz zur Richtlinie beleuchtet. Allerdings geht es dann auf YouTubes Seite vorrangig gar nicht mehr um das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, sondern – wie auch auf Urheberseite – um die Grundrechte der Berufsfreiheit und der Eigentumsfreiheit (bzw. noch genauer das Grundrecht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb). Denn YouTube versteht sich ja bekanntlich ausschließlich als „Plattform“. D.h. YouTube möchte sich den Inhalt hochgeladener Clips auf gar keinen Fall zu eigen machen und würde sich in dem beschriebenen Fall daher sicherlich nie auf die Meinungsfreiheit berufen. Noch weniger könnte YouTube eine Beschränkung der Meinungsfreiheit seiner Nutzer geltend machen, denn das wäre wiederum ein Fall der oben beschriebenen und in Deutschland nicht vorgesehenen Popularklage (s.o.).
Auch auf diesem Wege kommt man also nicht zu dem Ziel einer Überprüfung von Art. 13 Abs. 4 der Copyright-Richtlinie („ensure the unavailability“) im Lichte des Grundrechts der Meinungsfreiheit.
Überprüfung der RL, Option b: Normenkontrollklage
Eine weitere realistische Möglichkeit wäre eine so genannte abstrakte Normenkontrollklage, die z.B. von der Opposition erhoben werden könnte. Argumente für eine Verfassungswidrigkeit der Richtlinie bzw. des deutschen Umsetzungsgesetzes müsste nach den schon auf das römische Recht zurückgehenden Regeln des streitigen Parteienprozesses in diesem Fall allerdings zuerst einmal der Antragsteller und nicht die verteidigende Bundesregierung bringen. Klingt trivial, ist aber bedeutsam. Man könnte salopp sagen: Das deutsche Prozessrecht legt Rollen fest. Der Kläger (z.B. die klagende Opposition) ist der Angreifer, der Beklagte (die Bundesregierung, die den Gesetzentwurf verantwortet) ist der Verteidiger. Nach den prozessualen Regeln muss der Angreifer erst einmal Argumente für seine These liefern, das Gesetz sei verfassungswidrig.
Und dann müssten die Gegner endlich Butter bei die Fische tun.
Es reicht ab diesem Punkt eben nicht mehr aus, mit Leerformeln wie „desaströs“ zu arbeiten.
Selbstverständlich wird es bei unterstelltem Einsatz von Uploadfiltern „False Positives“ geben. Aber im Verfassungsrecht gilt das Prinzip der praktischen Konkordanz. Und das bedeutet, der de lege ferenda durch False Positives entstehende Schaden für die Meinungsfreiheit müsste gegen den de lege lata bereits existierenden und jeden Tag wachsenden Schaden für die Eigentumsfreiheit der Urheber abgewogen werden. Letzterer ist auch unter dem Begriff Value Gap bekannt und wissenschaftlich schon recht gut untersucht (Bsp.: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-20265-1_12).
Zu dem erwarteten Schaden durch False Positives gibt es hingegen nur eine Menge belegfreie Glaskugelei der Art.-13-Gegner. Wobei Glaskugelei schon zu viel gesagt ist, denn der Schaden wird ja einfach nur behauptet, ohne ihn irgendwie zu konkretisieren oder zu begründen.
FAZIT: Entwarnung
Ich persönlich vermute, dass das Problem maßlos überschätzt wird und will auch erklären, warum. Man stelle sich eine gigantische Torte vor. Diese Torte ist der globale zwischenmenschliche Austausch über alle denkbaren Kanäle von Buschtrommeln bis Satellitenhandy. Von dieser Torte ist m.E. nur ein eher kleiner Teil internetgestützt. Von diesem internetgestützten Teil entfällt wiederum nur ein kleiner Teil auf die von Art. 13 Copyright-Richtlinie erfassten Plattformen. Von diesem kleineren Stück eines kleineren Stücks beinhaltet jetzt wiederum nur ein kleiner Bruchteil Drittcontent. Von diesem Bruchteil eines Bruchteils eines Bruchteils werden die gefürchteten Filter wiederum nur einen Bruchteil erfassen und nur ein Bruchteil davon wird letztendlich tatsächlich „False Positives“ aufweisen.
Unter dem Strich wird durch False Positives also nur ein verschwindend geringer Teil der globalen Gesamtkommunikation erfasst. Ein Verfassungsgericht, welches diesen Schaden gegenüber dem Schaden des Value Gap abwägt, wird auch in Rechnung ziehen, dass das Kommunikationshindernis durch Filterung ja kein endgültiges ist, denn der von einer solchen Filterung Betroffene hat andere Möglichkeiten seine Meinung zu äußern, nämlich
- den in der Richtlinie vorgesehenen Redress-Mechanismus (Art. 13 Abs. 8);
- den Rechtsweg;
- die Möglichkeit, seine Meinung ohne das für die Filter problematische Beiwerk auf demselben Wege noch mal zu posten (der U aus unserem Ausgangspunkt schreibt dann eine Videotafel mit dem Inhalt die „GroKo ist imperialer als der Todesstern“ und lädt sie hoch) oder
- die Veröffentlichung seiner Meinung über einen anderen Kanal (nicht von Art. 13 erfasste Plattform oder außerhalb des Internets).
Zieht man hierzu auch noch die diversen Safeguards der Richtlinie in Betracht, wie z.B. den Verweis auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip (Art. 13 Abs. 4 a), die ausdrückliche Ausnahme von Schrankenbestimmungen zu Zitat, Parodie etc. (Art. 13 Abs. 5), das Verbot genereller Überwachung (Art. 13 Abs. 7) und die Ausnahmen für Startup-SMEs, kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass der zu erwartende Schaden für die Meinungsfreiheit als so „desaströs“ eingeschätzt wird, dass er durch die Eindämmung des „Value Gap“ nicht aufgewogen wird.
Dabei wird möglicherweise auch eine Rolle spielen, dass die Bundesverfassungsrichterinnen und –richter alle in einem Alter sind, welches es ihnen ermöglicht, sich daran zu erinnern, dass es auch schon vor dem Internet möglich war, Meinungsaustausch zu betreiben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Richterschaft sich von dem so gern vorgebrachten Argument beeindrucken lässt, es handele sich bei ihr um einen Haufen alter Menschen, die das Internet nicht verstanden haben. Für mich übrigens nebenbei gesagt eine besonders platte und bösartige Form von Ageismus. Man könnte genauso gut oder vielmehr schlecht behaupten, netzaffine, junge Menschen hätten die Fähigkeit verloren, über den Tellerrand des Internets hinauszuschauen.
Leider ist eine Debatte in dieser analytischen Tiefe derzeit nicht mehr möglich und zwar spätestens seit MdEP Julia Reda auf die geniale Idee verfallen ist, mit platten Lügen wie „Memes werden verboten“ Teenager zur politischen Beeinflussung ihrer Eltern zu instrumentalisieren.
____
TL;DR: Alle Gegner des Art. 13 reden von Zensur und den „desaströsen“ Auswirkungen der zu erwartenden Uploadfilter, dabei
- ist die Frage der Einrichtung wie auch der genauen Konfiguration der Filter (nur Maschine oder Mensch & Maschine) letztlich eine autonome Entscheidung der Plattformen;
- ist die angebliche Desaströsität für die Meinungsfreiheit nicht nur völlig unbelegt, sondern auch noch kontraintuitiv und
- würde diese bei einer verfassungsrechtlichen Überprüfung mit den Schäden durch den Value Gap abgewogen werden;
- sind Uploadfilter beim besten Willen keine Zensur im rechtlichen Sinne.
_________ [edit, mh 4,3,2019] ___________
Liebe Kommentierende,
leider lassen es meine Familie und meine beiden Brotberufe nicht zu, mich angemessen mit Ihren Kommentaren auseinanderzusetzen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich nicht mehr selbst in die Debatte eingreife. Ich freue mich aber, dass mein Beitrag offensichtlich zu weiterem Nachdenken angeregt hat. Bitte missverstehen Sie mein Schweigen nicht als mangelnde Wertschätzung Ihrer Kommentare.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Elbel






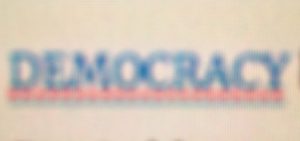 Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter.
Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter.