Die Freiheit sei in Gefahr, heißt es. Das Internet, so wie wir es kennen, stehe vor dem Ende und drohe kaputtzugehen. Dabei ist das Internet längst kaputt. Und die Ankündigungen seines Endes seit zwei Dekaden vertraute Folklore. Wenn wir nicht beginnen, das Netz grundrechtskompatibel nach den Prinzipien der Vielfalt und Nachhaltigkeit zu gestalten, geben wir die letzten Reste tatsächlich vorhandener Freiheit auf.

Eigentlich bin ich ja Komponist und Musikproduzent. Zur Zeit jedoch, ist mein Leben voll von unendlichen, sich verzweigenden, gelegentlich verständnisvollen, oft wütend-aggressiven Auseinandersetzungen um den vom Rechtsausschuss des EU-Parlaments verabschiedeten Richtlinienentwurf zur Vereinheitlichung des Urheberrechts im Digitalen Binnenmarkt.
Das Verrückte an der Situation – und ich bitte darum, das Wort wörtlich zu nehmen: es ist etwas verrückt, verschoben, nicht mehr an seinem Platz – ist die offenbar mehr oder weniger unauflösliche Lagerbildung. So fallen alle Befürworter der in Artikel 13 vorgeschlagenen Regel unter den Pauschalverdacht, leichtfertig die Meinungsfreiheit infrage zu stellen – darunter unter anderem die Aktivistinnen und Aktivisten vom PEN-Zentrum Deutschland, die unter größtem persönlichen Einsatz verfolgte Schriftsteller und Journalisten aufnehmen, betreuen, verteidigen: absurd.
Ein Hinweis auf die Blindheit, mit der wir alle – sicher auch ich – durch unsere Kriegsgräbenperspektive geschlagen sind. Von so weit unten kann man kaum einen Überblick gewinnen.
Was aber zwingend nötig wäre, das ist einerseits eine holistische Perspektive. Es geht um viel. Ja, auch um Technologie, um das Netz, vor allem aber geht es doch wohl um die Menschen, die es nutzen, und um gesellschaftliche Räume.
Da wir die Räume unseres digitalen Zusammenlebens über Richtlinien wie diese gestalten, wäre andererseits ein sehr viel sorgfältigerer Blick auf Hintergründe, Strukturen, Details und auch auf tangierte Rechte vonnöten. Selbstverständlich sind Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit nicht verhandelbar; bei allem grundsätzlichen Dissens kann ich in diesem Punkt nur Gemeinsamkeiten zwischen den Lagern erkennen. Gleichzeitig ist die Aushandlung fairer und nachhaltiger Beschäftigungs- und Beteiligungsbedingungen gerade angesichts der nach wie vor weitgehend unregulierten Vormacht supranationaler, oft monopolistischer Infrastrukturanbieter und Intermediäre unverzichtbar und zusehends unaufschiebbar. Gemeinhin wird die Kultur- und Kreativwirtschaft, mit ihrem außerordentlich hohen Anteil an Soloselbständigen, als Experimentierfeld für eine neue, digitale Erwerbswelt betrachtet. Doch die Plattformökonomie schafft Fakten, formt Strukturen, und das oftmals alleine auf Basis renditeorientierter korporatistischer Anliegen und abseits jeglicher Gemeinwohlorientierung.
Es bedarf dringend, unbedingt und umgehend einer entschiedenen verbalen Abrüstung. Denn wer so leichtfertig, wie derzeit zu beobachten, mit einem Begriff wie ZENSUR hantiert, der riskiert, dass der Blick auf tatsächliche, absichtsvolle Zensurbestrebungen, auf den Versuch also, Meinungen und Fakten systematisch und interessengeleitet der Öffentlichkeit vorzuenthalten, nicht scharf genug ist, wenn genau das passiert.
Schließlich, und das ist gewissermaßen eine Art Metakritik, wäre es angebracht, die Perspektiven der unmittelbar Betroffenen nicht auszuklammern. Nach meiner Beobachtung aber ist genau das im vorliegenden Fall auf breiter Front geschehen. Wir sprechen hier über eine europäische Urheberrechtsrichtlinie, und nicht etwa über einen Presseleistungsschutzrecht+Uploadfilter-Erlass. Hand aufs Herz: In wie vielen Artikeln der letzten, aufgeheizten Wochen, ist Ihnen ein „Urheber“ begegnet? Gar zu Wort gekommen? In so gut wie keinem. Weil das alles angeblich viel zu kompliziert ist, um es in einer Öffentlichkeit zu verhandeln (wobei nach meinem Verständnis genau hier, in der Reduktion von Komplexität ohne dabei populistisch zu werden, die von den Presseverlagen behauptete unverzichtbare Aufgabe der Presse läge …) – und weil die Eigeninteressen der Redaktionen, die immer weiter die Mauern zwischen Meldung und Meinung einreißen, viel zu selbstreferenziell sind, um auf das Gewusel am Boden (da, wo es fruchtbar ist) der Kultur- und Medienwirtschaft zu achten. Letztlich haben sich über Wochen und Monate die Redaktionen mit ihren Verlagen auseinandergesetzt (was immerhin ein Beleg für die Redaktionsfreiheit ist) und dabei die Presseveröffentlichungen in Geiselhaft genommen.
Diskursiv passiert zudem etwas Bezeichnendes für den Umgang mit Kultur in Deutschland. Die hat, in der öffentlichen Meinung, immer mehr auch in der Politik und dort zumal im rotgrünen Milieu, stets einen KW-Vermerk. „Kann wegfallen“ aka „muss man sich halt leisten können.“ Dabei war wohl nie in der Geschichte dieser Republik eine lebendige, lust- und kraftvolle, komplizierte, identitätsstiftende Kulturarbeit wichtiger, um manipulativen und populistischen Gleichschaltungsbestrebungen etwas entgegenzusetzen (#meinungsfreiheit). In diesem Klima ist es nach wie vor verpönt, Kultur (rein) in einen Zusammenhang mit Geld (unrein) zu bringen, oder gar mit verbindlichen Rechtsansprüchen wie Lizenzierung und Vergütung …

Der teilweise vergiftete Diskurs findet nicht in luftleeren (oder rechtsfreien) Räumen statt. Es gibt Gesetze, die die Möglichkeit von Kunst und Kultur gewährleisten, solche, die den Zugang sicherstellen und dann die, die sich mit Fragen von Vergütung und Erlaubnisvorbehalten befassen. Schließlich gibt es Regeln auf supranationaler Ebene, wie die EU-Grundrechtecharta oder, nicht zuletzt, die völkerrechtlich verbindliche UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt, die sowohl die EU als auch sämtliche ihrer Mitgliedsländer gezeichnet haben. Letztere übrigens definiert den sog. „Doppelcharakter kultureller Güter“ als eine prinzipielle Eigenschaft; diese seien immer zugleich Güter eines Markts und der Kultur an sich: Vergütung und kulturelles Schaffen bedingen sich gegenseitig.
Verfassungsrechtlich ist das sogar noch konkreter zu fassen. So warnt der ehemalige Verfassungsrichter Udo di Fabio in seiner verfassungsrechtlichen Studie „Urheberrecht und Kunstfreiheit unter digitalen Verwertungsbedingungen“ (München, C.H.Beck 2018) davor, „Ansprüche und Rechte von Urhebern […] als Ausdruck ‚veralteten‘ Denkens“ (di Fabio S.23) zu begreifen. Es sei seit jeher Aufgabe des Urheberrechts, „einen fortwährenden Ausgleich der unterschiedlichen Interessen von Grundrechtspositionen von Urhebern, Vermittlern, Dienstleistungsanbietern und Nutzern“ (ebd.) zu leisten. „Fester Ausgangspunkt – und nicht etwa beliebiger Abwägungsbelang – bleibt dabei das Herrschafts- und Bestimmungsrecht des Urhebers über sein Werk“ (ebd.), dessen Recht im Übrigen keineswegs nur materiell, also in einem Eigentumsrecht begründet sei, sondern ebenso in dem ihm untrennbar anhaftenden Urheberpersönlichkeitsrecht.
Die „technologie- und renditegetriebene Entwicklung“, so di Fabio, führt „immer mehr zu einer Entrechtlichung der Werkverwertung im Internet und gefährdet verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte, Strukturen und Institutionen. […] Der Urheber wird – wenn er nicht Hebel der Rechtedurchsetzung in die Hand bekommt – zu einem in seinem wirtschaftlichen Erfolg ungewissen Destinär, und zwar hinsichtlich der Früchte seines, mit seiner Person verbundenen, indes von anderen mit Wertschöpfung zu ihren Gunsten in Umlauf gebrachten Werks.“ (di Fabio S.24f.) Diese Form der Abhängigkeit aber gefährde ganz konkret die Kunstfreiheit des Urhebers. Nicht grundlos sei im Urheberrecht eine Lizenzierungs- und Vergütungspflicht vorgesehen. Vergütungspflicht und Kunstfreiheit seien untrennbar, so der Verfassungsrechtler di Fabio.
#Bäm.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Wertschöpfung in der Musik, sprich: auf die Mechanismen und Strukturen der Vergütung, denn besonders hinsichtlich YouTube hat die Musikbranche sicher den größten Leidensdruck.
Als Komponist lebe ich im und vom Urheberrecht, und das zu 100 Prozent. Sämtliche Erlöse, die ich mit meinen Werken und deren Aufnahmen erzielen kann, basieren auf Rechtsansprüchen, einen Anspruch auf Arbeitsvergütung – so wie Dienstleister – haben Musikautoren nicht. So gut wie jeder Songwriter arbeitet auf eigenes Risiko: werden seine Werke in relevantem Umfang genutzt, steht ihm eine „angemessene“ Vergütung durch die Werknutzer zu. Um das Werk nutzen zu dürfen, bedarf es im Regelfall einer Nutzungsgenehmigung, d.h. einer (vergütungspflichtigen) Lizenz. Für manche Nutzungen bedarf es auch mehrerer Lizenzen, etwa in allen Fällen, in denen Musik mit Bildern synchronisiert wird. Die Kopplung der Musik mit Bildern ist laut Gesetzgeber eine Bearbeitung – und damit genehmigungspflichtig. Das sog. „Filmherstellungsrecht“ schützt nicht die materiellen Interessen des Rechteinhabers, sondern die Persönlichkeit des Werkschöpfers; es basiert auf dem Urheberpersönlichkeitsrecht, das als grundrechtlicher Anspruch eng verwandt ist mit dem Recht auf Informationelle Selbstbestimmung.
Beim Upload eines Videos auf eine Plattform wie YouTube müssen zwingend mindestens folgende Rechte vorliegen:
- Das Recht am Werk (Nutzungsrecht, ein oder mehrere Urheber; gibt es beim Urheber oder bei der GEMA),
- das Recht an der Aufnahme (Nutzungsrecht, Aufnahmehersteller),
- die Rechte der Interpreten (Nutzungsrecht, Leistungsschutzrecht), zudem
- das Filmherstellungsrecht (Bearbeitungsrecht, vom Urheber oder der GEMA), welches benötigt wird, um die Musik in ein Video einzubauen.
Hier stellt sich nun die Frage, wer dafür zuständig, d.h. verantwortlich ist, diese Lizenzen zu erwerben. Derzeit sind dies die Uploader, die per AGB zusichern, im Besitz aller notwendigen Rechte zu sein. Man darf getrost davon ausgehen, dass die Mehrzahl aller AGB-Clicks ohne einen Blick auf deren Inhalt vorgenommen wird. Ob gelesen oder ungelesen, ob Vorliegen einer Lizenz oder nicht, tut im Übrigen ohnehin wenig zur Sache, denn in vielen Fällen sind die Inhaber der Nutzerkonten schlicht nicht bekannt oder nicht zu ermitteln (Wegwerf-Mail-Adressen), zumal bei YouTube keine Klarnamenpflicht für Uploader herrscht. YouTube selbst wiederum zieht sich auf die Position eines Infrastrukturanbieters zurück, der als Host Provider lediglich Serverplatz vermittelt und mit den Inhalten nicht zu tun hat. Dass das bislang möglich war, wenn auch wackelig, liegt an einer älteren Ausnahmeregelung der EU, einer Haftungsprivilegierung namens „Safe Harbour“, welche Host Provider solange von der Haftung für die Inhalte auf der Plattform befreit, wie sie keine Kenntnis von Rechtsverstößen haben. Gleichwohl wird gerade YouTube europaweit immer eindeutiger von Gerichten in die Verantwortung genommen – in genau der Richtung, die nun der Rechtsausschuss mit seinem RL-Entwurf einschlägt.
Die Einkünfte musikalischer Urheber stammen laut der Musikwirtschaftsstudie von 2015 zu knapp 60% von der GEMA: für die meisten professionellen Musikurheber (z.B. die Autoren der Songs von Helene Fischer), die eben nicht als Stars T-Shirts und Kaffeetassen verkaufen (Helene Fischer) oder als Musiker Tourneen spielen (der Gitarrist von Helene Fischer), ist das das einzige erzielbare Einkommen. YouTube aber hatte von 2009 bis 2017 keine Lizenz der GEMA und bestreitet bis heute die Verpflichtung eine haben zu müssen. Und das als mit Abstand größter, umfassendster und reichweitenstärkster Musikverwerter der Welt.
Es findet also Wertschöpfung statt, sogar in erheblichem Umfang, ohne dass diejenigen, mit deren Werken das Geld erwirtschaftet wird, an den Erlösen beteiligt werden. Ein Unding, und das zumal angesichts des unbegreiflichen Nutzungsumfangs, welcher Wettbewerbsnachteile für alle nach den Regeln spielenden Akteure im Markt bedeutet – und die komplette Ausblutung für Urheber und Interpreten, deren Primärmärkte aufgrund der freien Verfügbarkeit ihres Repertoires bedeutungslos werden … Die britische Musikbranche hat 2017 von YouTube insgesamt die Hälfte der Summe erhalten, die sie mit Vinyl (!) erlöst hat! Das sollte helfen, den Regulierungsgegenstand von Artikel 13 ein wenig zu dimensionieren, die als Value Gap bezeichnete strukturelle Wertschöpfungslücke.
 Nun wird es viele geben, die sagen: Moment mal, aber wir wissen doch, dass es in der Musikwirtschaft alles andere als fair zugeht („… man hört ja so einiges“, sagte mir neulich allen Ernstes ein Jurist).
Nun wird es viele geben, die sagen: Moment mal, aber wir wissen doch, dass es in der Musikwirtschaft alles andere als fair zugeht („… man hört ja so einiges“, sagte mir neulich allen Ernstes ein Jurist).
Danke für Ihre Fürsorge. Ja, ich höre auch so einiges; manches davon stimmt, vieles ganz sicher nicht oder nicht so, aber: Darum geht es hier nicht. Was nicht reinkommt, kann auch nicht verteilt werden – noch nicht einmal unfair. Allein darum geht es: Um die längst überfällige Beendigung eines parasitären Geschäftsmodells.
Die Plattformbetreiber in der Plattformökonomie garantieren keine kulturelle oder Meinungsvielfalt; sie gewähren Zugang nur zu ihren Bedingungen, Gestaltung erst Recht, sie erheben Daten in unbegreiflichen Umfängen, ohne von sich aus Rechenschaft abzulegen, sie zahlen nur unter Druck und dann schlecht (und im Falle von YouTube nie ohne NDA), sie entrichten kaum Steuern, sie verändern das gesellschaftliche Klima, ohne sich staatlichen und gesellschaftlichen Regeln und Prozessen zu unterwerfen. Im Gegenteil: Die Einflussnahme der GAFA-Giganten auf demokratische Prozesse ist vielfach beschrieben; nie war der Lobbydruck auf die Politik höher als im Zeitalter der Plattformen. Eindrucksvoll lässt sich das nachvollziehen anhand der DSGVO, deren parlamentarischen Weg die Kinodoku DEMOCRACY begleitet hat.
Der Lobbyansturm in der aktuellen Situation ist ungleich größer …
Der digitale Feudalismus gerät außer Rand und Band. Alleine schon deshalb ist es im Allgemeinwohlinteresse, an so zentraler gesellschaftlicher Stelle regulierend einzugreifen und den Plattformen ihre Grenzen aufzuzeigen. So wie im Datenschutz, im Steuerrecht, in den Bereichen Fake News und Hate Speech geschehen und im Medienrecht in Vorbereitung.
Dass dabei Angst vor Kollateralschäden entsteht, ist nachvollziehbar. Immerhin geht es um Eingriffe in einen Lebensraum – und um die absehbare Schmälerung von Gewohnheitsrechten. Worum es aber, anders als vielfach behauptet, kaum geht, sind Eingriffe in die Grundrechte der User. Artikel 13.1 des Richtlinienentwurf nimmt dazu explizit Stellung, indem ein Ausgleich zwischen den Grundrechten der User und der Rechteinhaber gefordert wird – ganz so wie im Urheberrecht ohnehin vorgesehen.
Der in Artikel 13 vorgesehene urheberrechtliche Mechanismus lässt sich in etwa folgendermaßen zusammenfassen: Die Tätigkeit der Plattformen wird als „communication to the public“ (quasi eine „öffentliche Wiedergabe“) definiert. Die Betreiber haften damit für die vorgehaltenen Inhalte und sind lizenz- und vergütungspflichtig. Der vorgesehene Weg einer umfassenden und rechtssicheren Lizenzierung ist der Erwerb einer weitreichenden Pauschallizenz bei einer zuständigen, staatlich beaufsichtigten Verwertungsgesellschaft, so wie im Rundfunk üblich und erprobt. Sollte eine solche Pauschallizenz nicht vorliegen, muss der Provider durch „geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen“ den Schutz der Werke gewährleisten. Es gibt im Richtlinienentwurfstext keinen expliziten Hinweis auf eine Verbindlichkeit von Uploadfiltern; der Begriff taucht nicht auf. Gleichwohl ist die Installation automatisierter Systeme zur Werkerkennung ein plausibles Szenario zur Umsetzung einer unter bestimmten Bedingungen möglichen Prüfpflicht.

Genau hier setzt die Sorge vor der Installation umfassender und mächtiger, weil weitgehend autonomer Kontroll- und Überwachungsmechanismen ein. Besonders wird bemängelt, dass das Filtersystem
- wenig bis gar nicht transparent sein könne (anhand welcher Datenbestände sollen Detektionen stattfinden?),
- nicht in der Lage sein könnte, zuverlässig zwischen Original, Zitat und Parodie zu unterscheiden, (Overblocking),
- Basis und Ausgangspunkt für weiterreichende Überwachungsmechanismen sein könne und so zum Grundstein eines …
- Zensurapparats werden könnte, zumal es ja …
- in die Hände von Privatunternehmen gelegt werde: Privatisierung der Rechtsdurchsetzung!
Beginnen wir mit der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung: Mit Verlaub, das ist Unsinn – oder eine Nebelbome. Amazon und eBay werden als Plattformanbieter immer wieder und immer deutlicher für das Agieren ihrer Händler in Haftung genommen; höchstinstanzliche Gerichte erlegen Plattformen Prüfpflichten auf …: der Betreiber muss seinen Laden sauber halten: das ist selbstverständlich. Der Staat greift dann ein, wenn der Betreiber seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wäre es denn erstrebenswert, dass der Staat ein Filtersystem betreibt: auf einer privaten Plattform und mit Zugriff auf die private Kommunikation von Abermillionen von Menschen? Eine absurde Idee. Und das umso mehr, als es eine klare Nähe zwischen dem Zensurbegriff und staatlichen Eingriffen gibt.
In der Abwägung tangierter Rechte muss man genau hinsehen: Die Rechte der Urheber habe ich weiter oben umrissen. Zu den Rechten eines jeden Bürgers gehört neben dem Recht auf freie Meinungsäußerung etwa das Zitatrecht; weitere Rechte sind in den sogenannten Schrankregelungen kodifiziert. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Rechte tatsächlich im konkreten Szenario des Uploads von Inhalten auf YouTube berührt werden, denn eines sollte man sich klar machen: Die zur Diskussion stehenden Plattformen sind privatwirtschaftliche Unternehmen, üblicherweise mit Unternehmenssitz in anderen Ländern. Wer auch immer als User oder Uploader ihre Dienste in Anspruch nimmt, hat keinerlei Recht auf ihnen irgendetwas zu tun. Es gelten die „Community Standards“ des Anbieters, das Hausrecht, gewissermaßen. Viele User-Uploads sind zudem schlicht und ergreifend – heute schon und nach geltendem Recht – illegal. Hier braucht man nach einem Recht der Nutzer gar nicht weiter zu gucken: es gibt keines. Die Meinungsfreiheit wäre demnach erst dann tangiert, wenn ein Inhalt tatsächlich aufgrund einer Meinung bzw. eines nicht genehmen Inhalts gesperrt würde. Da aber genau das erstens nicht vorgesehen und zweitens sogar im RL-Text untersagt ist und zudem, drittens, ein staatliches Eingreifen zur Gewährleistung der grundrechtlichen Meinungsfreiheit anstoßen würde, ist das Beharren auf diesem Aspekt nicht sonderlich seriös.
Hier lohnt es sich, einen Blick auf die User-bezogenen Aspekte des Artikels 13 zu werfen. Der Regelungsvorschlag des Rechtsausschusses vom 20.Juni liegt seit Montag, 02.Juli in englischer Sprache im Volltext vor [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0245&language=EN]. Er weist bei schneller Durchsicht einige Veränderungen („Amendments“) zur vorherigen Entwurfsversion auf, die insbesondere auf den Schutz der User abzuzielen scheinen:
- [-1] Die Plattform haftet für User Uploaded Content, sofern dieser nicht von einem kommerziellen Anbieter oder vom Rechteinhaber persönlich hochgeladen wurde.
- [1] Nicht-rechtsverletzende Inhalte sollen explizit verfügbar bleiben. (=> Dadurch würde Overblocking gewissermaßen unzulässig.)
- [1 & 1b] Die geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen (es sind keine Uploadfilter spezifiziert!), welche den Schutz der Werke gewährleisten sollen, müssen einen Ausgleich schaffen zwischen den Grundrechten der User und der Rechteinhaber. (=> lässt sich auch gegen Overblocking anbringen.)
- [1b] Dabei soll keine grundsätzliche Überwachung („monitor“) übertragener oder gespeicherter Informationen implementiert werden. (=> kein Überwachungsapparat, sondern eine Prüfung auf lizenzrechtlichen Status Quo.)
- [2] Die „content sharing service provider“ müssen effiziente und schnelle Beschwerde- und Entschädigungsmechanismen schaffen, um Missbrauch oder Beeinträchtigungen in der Umsetzung vorhandener Ausnahmen und Schranken des Urheberrechts zu vermeiden. (=> klar Anti-Overblocking.)
- [2] Im Beschwerdefall müssen unverzüglich klare und nachvollziehbare Begründungen für Sperrung vorgelegt werden. (=> Transparenzverpflichtung & Anti-Overblocking.)
- [2] Im Zusammenhang der geforderten Maßnahmen dürfen keine Personen identifiziert und keine personenbezogenen Daten erhoben werden. (=> keine Überwachung.)
- [3] Vorgesehen ist die Einrichtung von „Stakeholder Dialogen“ unter Teilnahme der Provider, der User und der Rechteinhaber … „to define best practices for the implementation of the measures referred to in paragraph 1 in a manner that is proportionate and efficient, taking into account, among others, the nature of the services, the availability of technologies and their effectiveness in light of technological developments.“ (=> Transparenz und Einbezug.)
Ganz ehrlich: Das klingt, alles in allem, nicht nach selbstlaufendem Überwachungsapparat, sondern nach vergleichsweise viel Transparenz und Vorsorge – inkl. Einbezug der User.

Was ich verblüffend finde: Es gibt doch offenbar eine große Deckungsgleichheit in der Anerkennung struktureller Missstände und im Bedürfnis daran etwas zu ändern. Eigentlich will jeder, dass Künstler an ihr Geld kommen. Zumindest sagt es jeder … Wenn es dann aber konkret wird, dann sind immer andere Aspekte wichtiger. Beispielsweise die abstrakte Befürchtung, ein Prüfmechanismus könnte missbraucht werden, um noch anderes zu prüfen.
Nur: Auf gerade den Plattformen, um die er hier ausweislich der RL ausschließlich geht, GIBT es diese Strukturen längst, und das absolut verbindlich, denn die Plattformen sind schon heute verpflichtet, das Wiederauftauchen eines schon einmal lizenzrechtlich gesperrten Inhalts zu vermeiden. Juristisch: Würde YouTube kerngleiche Rechtsverletzungen nicht durch ContentID detektieren und verhindern, würde die Plattform vom „Störer“ zum „Gehilfen“ – und in die volle Haftung geraten. Bislang agieren die Filter im Verborgenen, mehr oder weniger ohne Möglichkeit, sich gegen sie zu wehren. Mit der RL aber gäbe es erstmals einen Rechtsanspruch GEGEN Fehlentscheidungen. Das wäre doch komplett im Sinne aller User und Uploader, solange sie legal agieren, versteht sich. Damit könnte man auch den mutmaßlich fehlerhaft gesperrten „Pink Stinks“ zu ihrem Recht verhelfen, und das sogar „effizient und schnell“. Anders gesagt: Bislang hat niemand von uns irgendein Recht, irgendetwas zu tun auf den Plattformen. Mit der RL hätten wir ein Recht, etwas zu fordern. Wir alle. Erstmals.
So betrachtet, scheint mir der argumentative Bezug zur Meinungsfreiheit und zur Sorge vor „Zensur“ (geht’s nicht ne Nummer kleiner?) im konkreten Zusammenhang geradezu bizarr. Wie gesagt: Wir sprechen hier ja nun mal nicht von der ZDF Mediathek oder einer NRW-Bürgermedienplattform. Sollten dort systematisch Meinungen unterdrückt, Fakten verschwiegen werden, wäre das Zensur. Auf YouTube gilt halt Hausrecht – zumindest, solange wir die Richtlinie nicht durchkriegen.
Sollte die Richtlinie durchkommen, dann wird sie sicherlich abgeschliffen sein und an vielen wesentlichen Stellen unscharf. Das ist das Ergebnis des massiven Lobbyandrangs und vieler Kompromisse; das wissen wir nicht erst, aber besonders seit der DSGVO, die wirklich toll hätte werden können … eigentlich. Auf die daraus sich ergebende (vorübergehende) Rechtsunsicherheit für alle Akteure wird vielfach hingewiesen. Wie sollte ich dem widersprechen; das Problem ist offensichtlich. Aber es ist schlicht und sehr ergreifend der Zustand unserer Demokratie, der hier seinen Ausdruck findet. Damit müssen wir umgehen. Es ist ja beileibe nichts Neues, dass auf Eingriffe in die erprobten Mechanismen des Netzes zunächst Verunsicherung folgt, dann eine unbeliebte Phase des Richterrechts – und schließlich Rechtssicherheit.
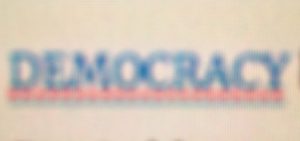 Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter.
Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter.
Worum es nicht geht, was wir uns wirklich verbieten sollten in diesem Gebrüll, das so gerne eine Debatte wäre: um Zensur. Denn die findet statt, vor unserer Haustür, bei unseren Nachbarn. Der ORF beispielsweise – immerhin eine deutschsprachige öffentlich-rechtliche Plattform – soll dieser Tage gleichgeschaltet werden. Von oben und als ganz offensichtlicher Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit: Dem müsste unser Aufschrei gelten! Ein lauter und gemeinsamer, wohlgemerkt.
Apropos Gemeinsamkeit: Sollten wir uns im Zuge der Güterabwägung darauf verständigen, dass wir die existenziellen Sorgen der Urheber und Interpreten anerkennen, müssten wir deswegen, wie gezeigt, die Ansprüche der User keineswegs aufgeben. Sie bekämen ja erstmals solche zugestanden.
Gemeinsam könnten wir auf dieser Basis überlegen, wie wir es hinbekommen, das Internet zu einem faireren Ort zu machen und zugleich die Filtertechnologien so weiterzuentwickeln und zu optimieren, dass sie unseren Ansprüchen genügen. War das nicht eigentlich das Versprechen des Netzes als eines sozialen Orts: Dass alle zu ihrem Recht kommen – und uns die Technik dabei hilft?!
Was hingegen – schon aus Gründen der Logik – nicht infrage kommt, ist, dass wir als Gesellschaft Technologien, die längst und verbreitet im Einsatz sind, diskursiv dafür missbrauchen, die missliebigen, aber immerhin grundrechtsbasierten Ansprüche einer lästigen Gruppe von Verfechtern des Geistigen Eigentums zu delegitimieren und abzuschmettern. Wer so argumentiert und agiert, sollte sich besser nicht auf die Idee von Freiheit berufen: Man könnte es ihm als den Ruf nach Vergütungsfreiheit auslegen. Als Gewohnheitsrecht.
 Katharina Uppenbrink, Prof. Dr. Karl Riesenhuber und Matthias Hornschuh. Fotos: ©IU/gezett
Katharina Uppenbrink, Prof. Dr. Karl Riesenhuber und Matthias Hornschuh. Fotos: ©IU/gezett

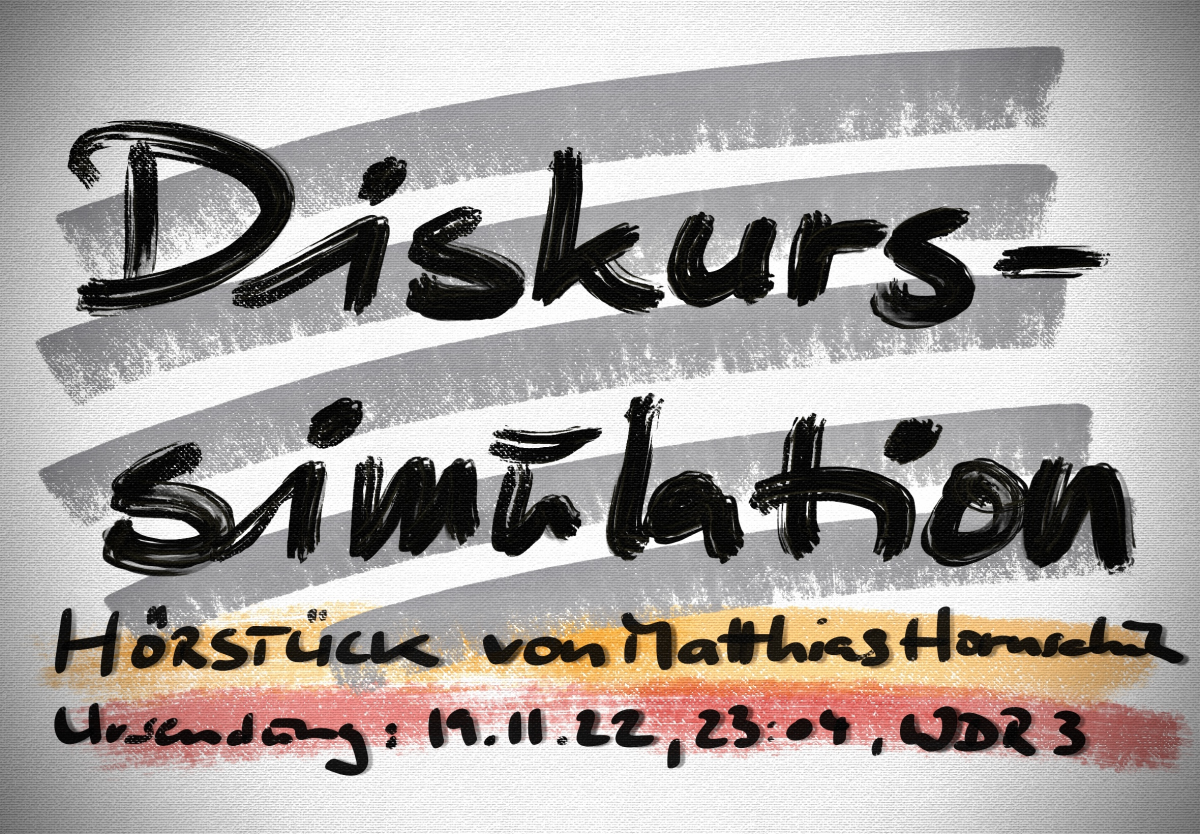
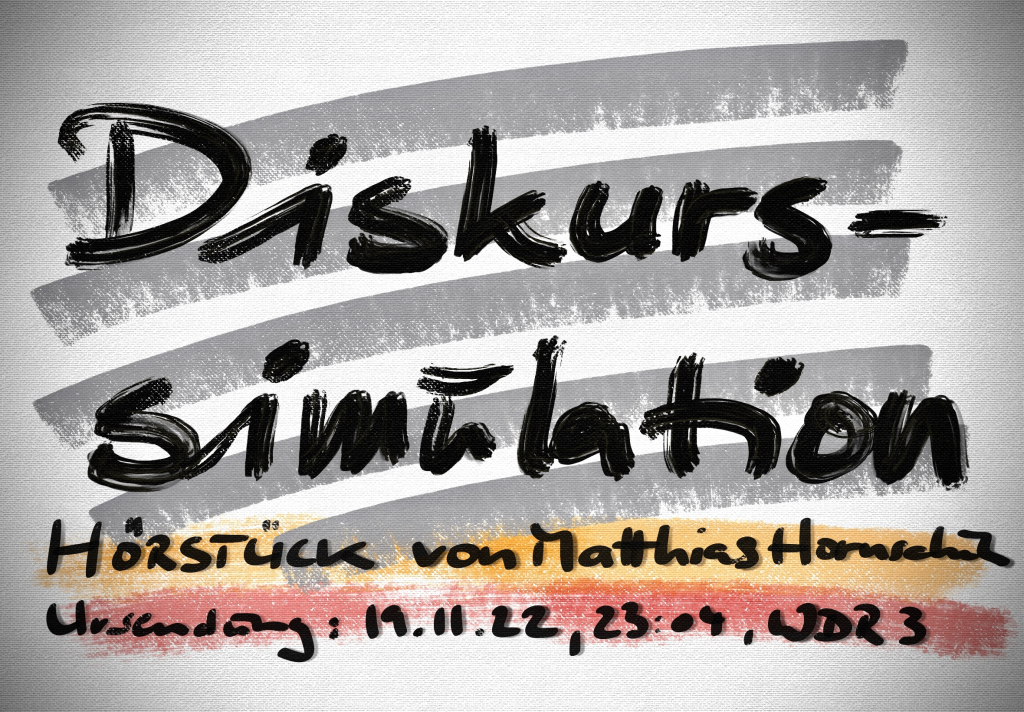

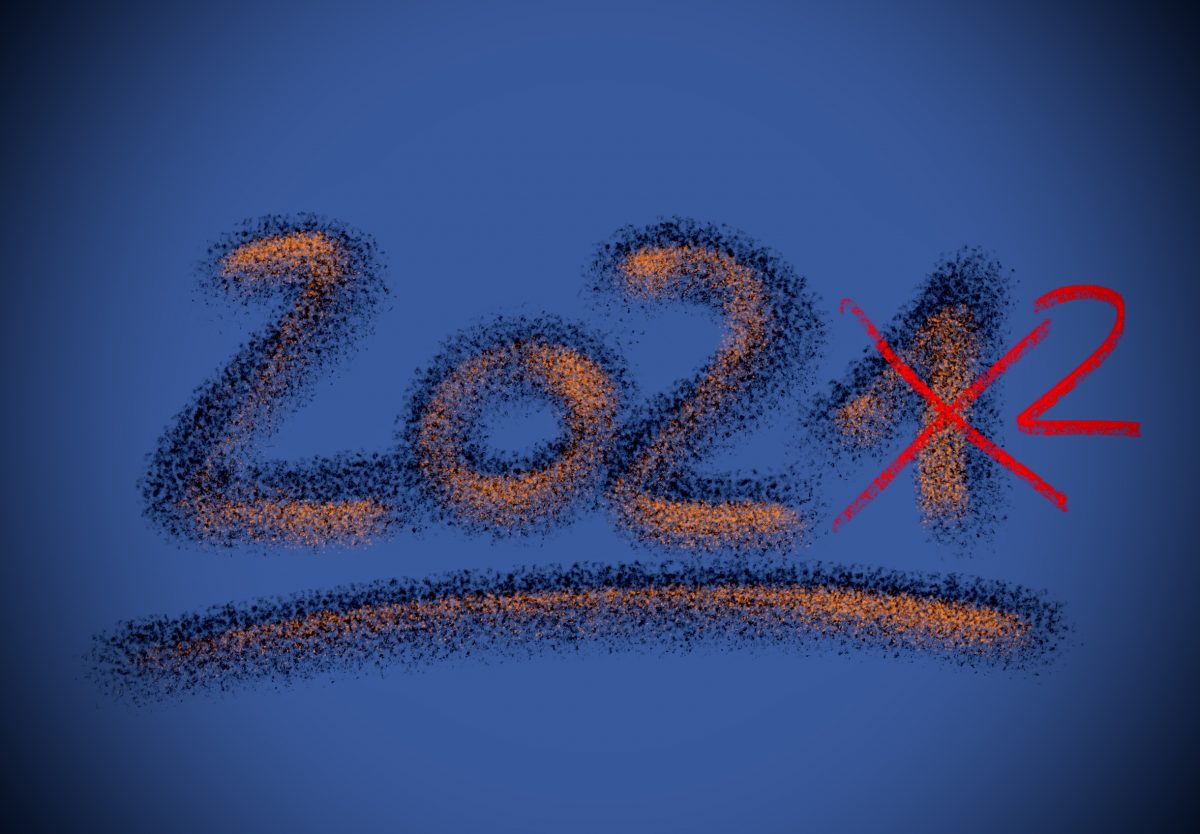



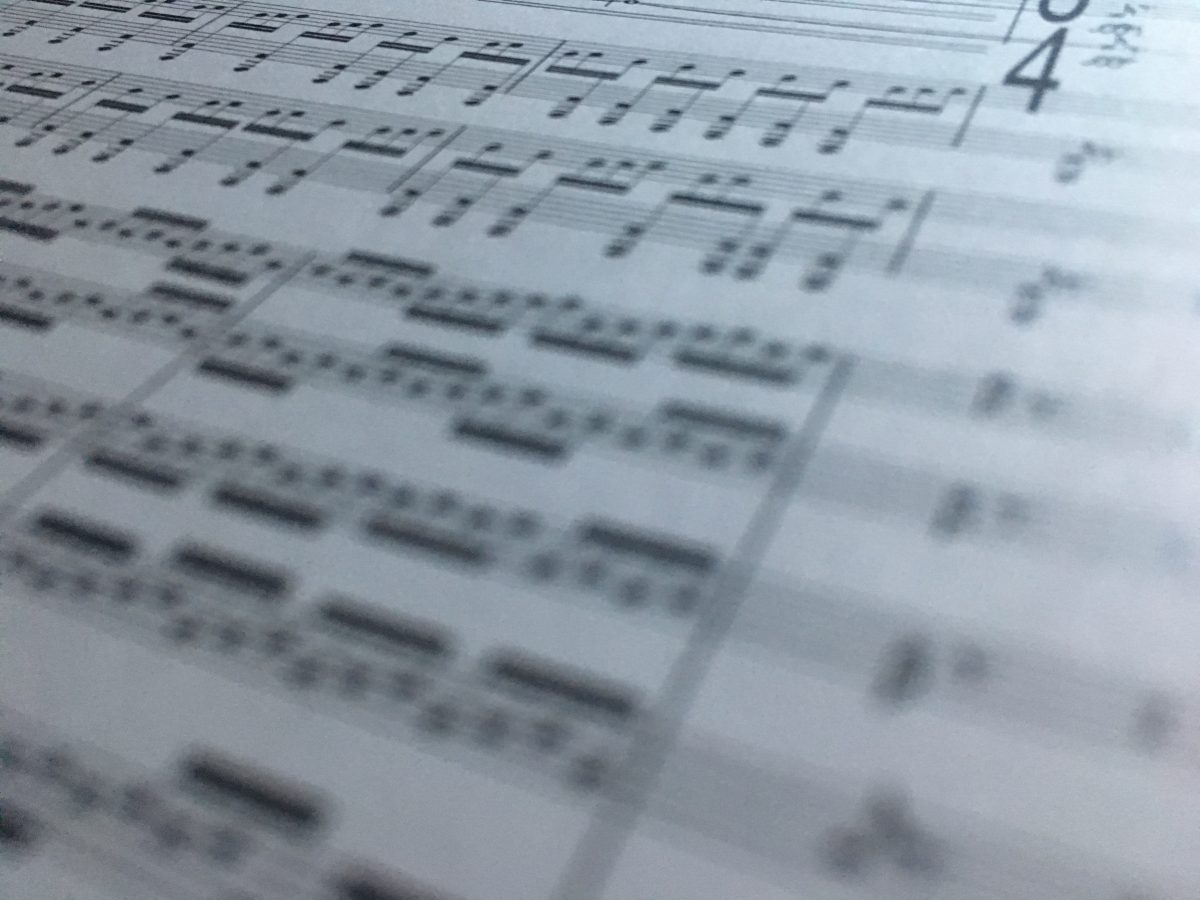





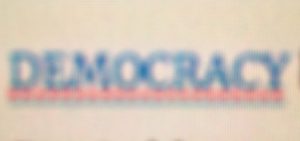 Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter.
Schlussendlich geht es um eine Güterabwägung. Um die Betrachtung verschiedener Rechtsgüter, um die mehr oder minder berechtigten Interessen von Mehr- oder Minderheiten, um digitale Kulturtechniken, um einen öffentlichen Raum, der bislang nicht nach öffentlichen Regeln funktioniert – und um die Beendigung eines unethischen, parasitären Geschäftsmodells, das so gar nicht zu der blumigen Vorstellung vom freien, gleichen Netz passen will, das hier verteidigt werden soll. Und, ja, es geht um Kunst- und Meinungsfreiheit, diese für unsere Identität so fundamentalen Güter. 